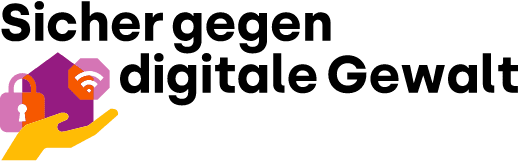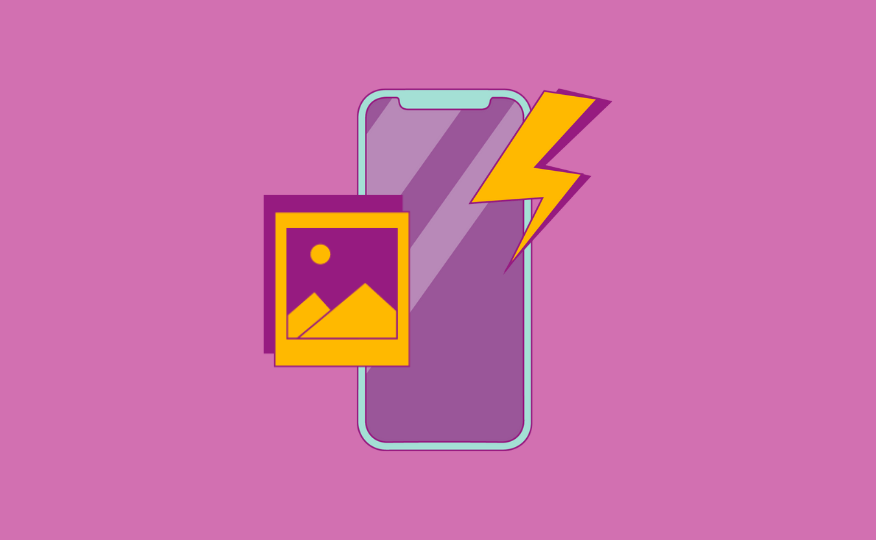Bildbasierte sexualisierte Gewalt
Überblick
Werden intime Fotos ohne Zustimmung gemacht oder geteilt, wird dies als bildbasierte Gewalt bezeichnet. Sie trifft überwiegend Frauen und findet oft in (Ex-)Partnerschaften statt. Für Betroffene führt sie zu Scham, Angst und massivem Kontrollverlust. Dieser Beitrag gibt für Fachkräfte einen Überblick über diese Gewaltform.
Was ist bildbasierte Gewalt?
Von bildbasierter Gewalt spricht man, in folgenden Situationen (klicksafe 2024):
- Nicht-einvernehmliches Erstellen von intimen Fotos und Videos
Ein Täter erstellt ohne Zustimmung der Betroffenen intime Fotos und Videos. Das Bildmaterial wurde dabei nicht einvernehmlich aufgenommen oder wurde sogar künstlich erzeugt. - Androhung, intime Fotos oder Videos zu verbreiten
Auch die Erpressung eines Täters intimes Bildmaterial zu verbreiten, kann sehr belastend für Betroffene sein. Im Kontext von (Ex-)Partnerschaftsgewalt versuchen die Täter so meist die Kontrolle über die Betroffenen zu behalten. - Nicht-einvernehmliches Verbreiten von intimen Fotos und Videos
Der Täter verbreitet intimes Bildmaterial im sozialen Umfeld (an Freund*innen, Familie, Arbeitsumfeld) oder auch öffentlich auf Plattformen im Internet. Das ungefragte Zusenden von Fotos mit sexualisiertem Inhalt (sogenannte Dickpics) ist ebenfalls Teil davon.

Was ist intimes Bildmaterial?
Fotos von Betroffenen können auch als „intim“ wahrgenommen werden, wenn weder Nacktheit noch Genitalien abgebildet sind. Intim können auch Fotos und Videos sein, die eine Person bei Aktivitäten zeigt, der sie normalerweise in ihrer Privatsphäre nachgeht. Beispielsweise kann für Personen, die Hijab (Kopftuch) tragen, ein Foto, das sie ohne Hijab zeigt, ein intimes Foto sein (Hussein 2024).
Der Begriff „intimes Bild” umfasst somit auch Fotos oder Videos, die aufgrund des sozialen oder kulturellen Hintergrunds der Betroffenen als intim gelten können, aber weder Nacktheit noch Sex zeigen. Deshalb ermöglicht der Begriff bildbasierte Gewalt ein breiteres Verständnis als der Ausdruck bildbasierte sexualisierte Gewalt (Hussein 2024).
Bildbasierte Gewalt ist überwiegend (Ex-)Partnerschaftsgewalt
In Deutschland gibt es bisher keine belastbaren Daten zu dem Thema. Eine empirische Studie aus dem Jahr 2021 in Australien, Neuseeland und Großbritannien ergab jedoch:
„dass 37,7 % der Befragten schon einmal Opfer von bildbasierter sexualisierter Gewalt wurden. Dabei dürfte von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen sein, da nicht jede betroffene Person von ihrer Viktimisierung weiß. 60,9 % der Betroffenen erlebten bildbasierte sexualisierte Gewalt im Zusammenhang mit einer gegenwärtigen oder beendeten intimen Beziehung.Bei 18,6 % der Befragten war der*die Täter*in ein*e Freund*in oder eine Person aus dem erweiterten sozialen Umfeld, bei 8,3 % der Betroffenen eine unbekannte oder fremde Person, bei 5,9 % ein Familienmitglied, bei 3,8 % eine Person aus dem beruflichen Kontext.“
(Henry et. al 2020 zit.n. Deutscher Juristinnenbund 2023: 2).
Auswirkungen für Betroffene
Jede Betroffene erlebt bildbasierten Missbrauch anders. Einige fühlen sich betrogen, verängstigt, wütend oder gedemütigt. Andere schämen sich oder sind verlegen, insbesondere wenn sie dazu verleitet oder gedrängt wurden, Aufnahmen zu teilen. Manche haben auch Angst, dass sie in Schwierigkeiten geraten könnten, wenn ihr soziales Umfeld davon erfährt (eSafety 2025). Täter zielen mit bildbasierter Gewalt auf Schamgefühle der Betroffenen, deshalb ist es für Beratende umso wichtiger Täter-Opfer-Umkehr zu vermeiden und Betroffene zu stärken.
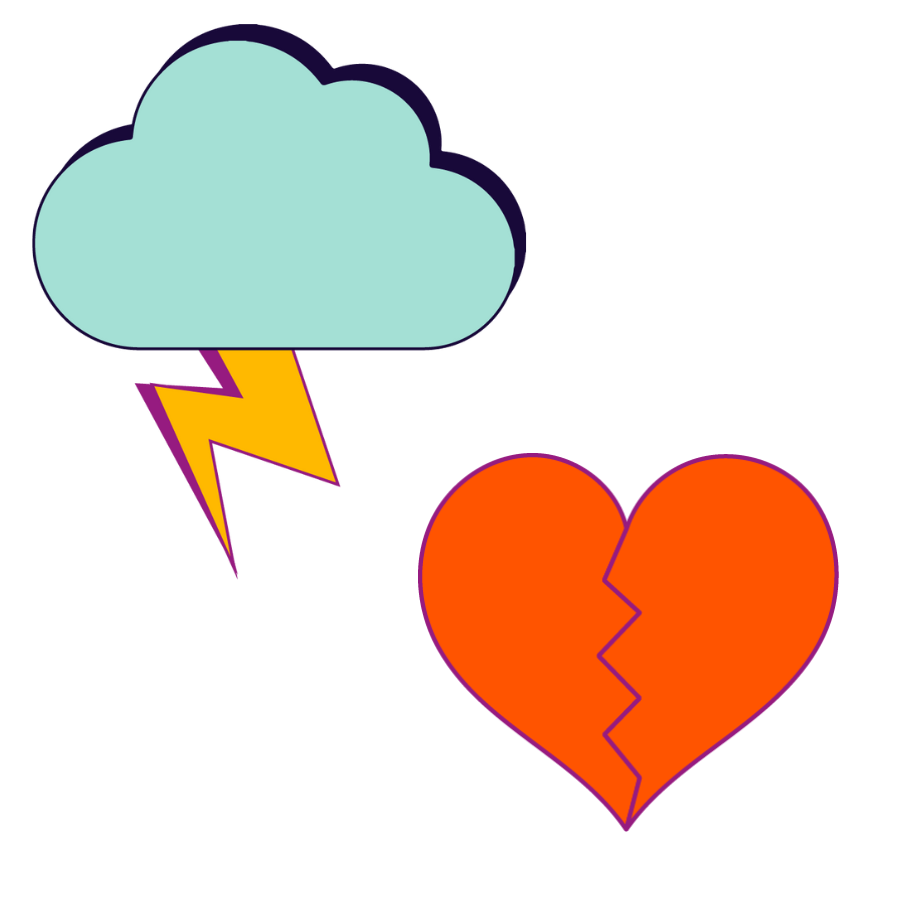
Woher haben Täter die Fotos und Videos?
Ein Täter kann auf verschiedene Weise in den Besitz von intimen Fotos oder Videos gelangen (Tech Safety Australia 2025), z. B. indem er Bildmaterial:
- mit Zustimmung der Betroffenen aufgenommen hat.
- ohne Zustimmung der Betroffenen aufgenommen hat.
- von der Betroffenen zugesendet bekommen hat.
- gestohlen hat (z. B. durch Zugriff auf Smartphone oder Cloud).
- digital so bearbeitet oder gefälscht hat, dass es den Anschein erweckt, dass es sich um echtes Bildmaterial der Betroffenen handelt (z. B. Fotomontage, Deepfakes).
Leider wird in einigen Fällen den Betroffenen in erheblichem Maß Schuld an der erlebten Gewalt gegeben. So wird ihnen zum Beispiel gesagt, dass sie das Bildmaterial nicht hätten aufnehmen oder teilen sollen. Egal ob eine Betroffene das Foto freiwillig in einer ehemaligen Beziehung an den Täter versendet hat oder der Täter ohne Zustimmung der Betroffenen an das Foto gelangt ist: Die Verantwortung liegt allein beim Täter. Der Täter hat kein Recht Bildmaterial ohne Zustimmung der Betroffenen zu erstellen und zu verbreiten. Die Betroffene ist nicht schuld.
Rechtliche Aspekte
Das Erstellen von Aufnahmen aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich ist in Deutschland strafbar (§ 201a StGB). Zu Deepfakes gibt es noch keine Regelung im Strafrecht. Wenn Täter Betroffenen mit intimen Fotos erpressen, kann das als Nötigung (§ 240 StGB) strafbar sein.
Die Weitergabe von Aufnahmen ohne Zustimmung der abgebildeten Person ist strafbar laut Kunsturhebergesetz (§33 KUG) und Strafgesetzbuch (§ 201a StGB). Das unaufgeforderte Versenden eines pornografischen Bildes, z.B. von Dickpics, ist ebenfalls strafbar (§ 184 StGB).
Bildbasierten Gewalt bei (Ex-)Partnerschaftsgewalt geht häufig auch mit anderen Straftaten einher, z. B. Nachstellung oder Verleumdung.
Die missbräuchliche Darstellung von Kindern ist ein eigener Straftatbestand. Dieses Thema wird hier nicht näher behandelt.
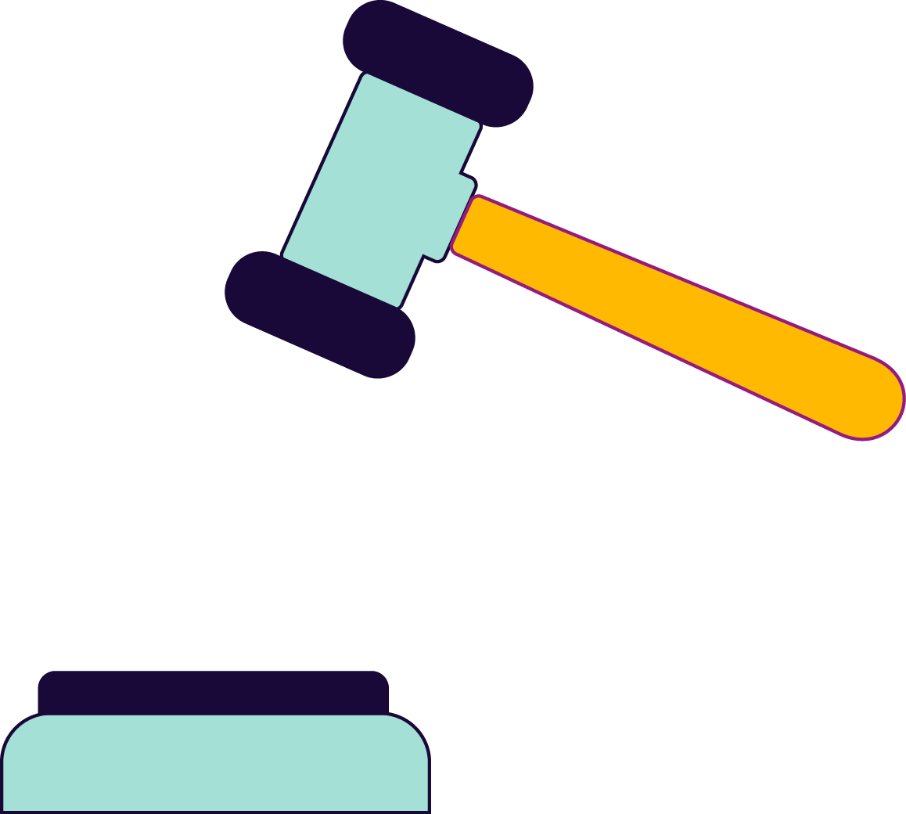
Sie haben bildbasierte Gewalt erlebt?
Sie sind nicht allein. Auf der Seite „Hilfe in der Nähe“ finden Sie Beratungsmöglichkeiten.
Quellen
- eSafety (2025): Managing the impacts of image-based abuse.
- Henry/McGlynn/Flynn/Johnson/Powell/Scott (2020): Image-based Sexual Abuse A Study on the Causes and Consequences of Non-consensual Nude or Sexual Imagery. Routledge.
- Hussein, H. (2025): Chayn is building a cultural map of what “intimate” means around the world.
- Klicksafe (2024): Sexualisierte Gewalt durch Bilder.
- Tech Safety Australia (2025): Image-based abuse.
Alle Links wurden am 05.11.2025 zuletzt abgerufen.
Verwandte Inhalte
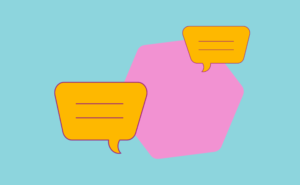
Grundsätze der Beratung

Was ist digitale Gewalt?

Auswirkungen digitaler Gewalt
ist ein mithilfe von künstlicher Intelligenz gefälschter Medieninhalt, der täuschend echt wirkt. Meist handelt es sich um gefälschte Video- oder Fotoaufnahmen.
ist ein Speicherplatz auf einem von vielen Servern irgendwo auf der Welt. Die Daten werden über das Internet übertragen und in einer Cloud gespeichert. Sie können jederzeit wieder über das Internet abgerufen werden.