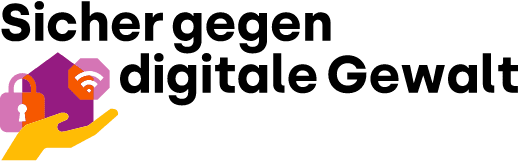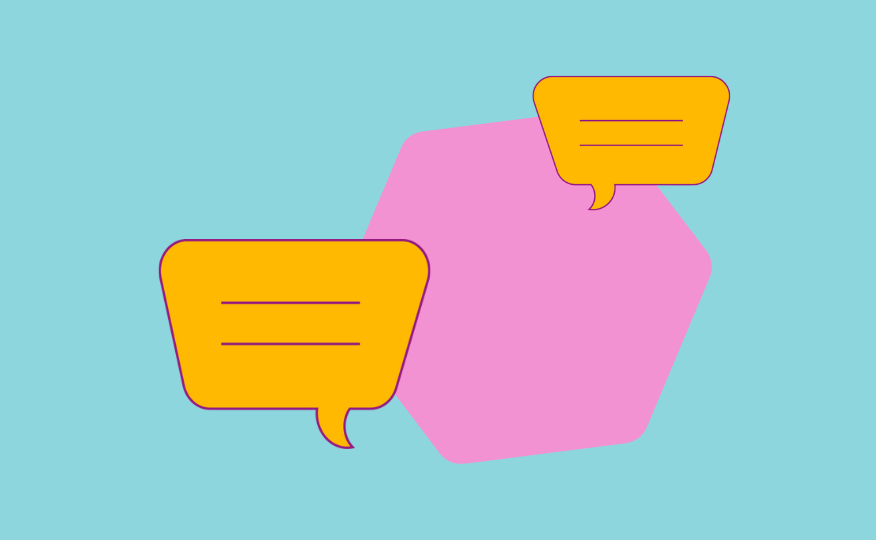Grundsätze der Beratung
Überblick
Warum ist es wichtig, Betroffene in ihrer digitalen Teilhabe zu stärken? Dieser Beitrag widmet sich fünf Grundsätzen zur Beratung bei digitaler (Ex-)Partnerschaftsgewalt. Der Beitrag lädt dazu ein, eine häufig technik-fixierte Sichtweise auf digitale Gewalt zu weiten, Mehrfachdiskriminierungen mitzudenken und Sicherheitsmaßnahmen gemeinsam mit Betroffenen zu entwickeln.
1. Technologien sind nicht das Problem, sondern dessen Missbrauch
Im Kontext von (Ex-)Partnerschaftsgewalt nutzen Täter digitale Wege als eines von mehreren Mitteln zur Gewaltausübung. Digitale Gewalt muss dabei nicht die hauptsächliche Gewaltform sein. Der Täter zielt darauf ab, Macht und Kontrolle in der Gewaltbeziehung aufrechtzuerhalten: Durch Technologien wird dies in einem größeren Umfang möglich.
Technologien sind für Täter ein neues Werkzeug für ein altes Verhalten. Die Verantwortung für das grenzverletzende Verhalten liegt dabei beim Täter, denn er nutzt die Technologien missbräuchlich (NNDEV 2025).
Vor allem, wenn ein Täter aus einer ehemaligen Beziehung sehr genau weiß, welche (digitalen) Alltagsroutinen die Betroffene hat, ergeben sich für ihn vielfältige Möglichkeiten zur Gewalt auszuüben.
Auch wenn Technologien nicht der Grund für die Gewalt sind, haben Plattformen und IT-Unternehmen die Verantwortung, ihre Produkte so zu gestalten, dass das Missbrauchspotential möglichst gering ist (sog. Safety by Design).
2. Betroffene haben ein Recht auf digitale Teilhabe
Für viele Betroffene ist das Smartphone eine wichtige Ressource. So können sie im Umfeld Unterstützung suchen und das Hilfesystem kontaktieren. Aber auch während des Frauenhausaufenthaltes können sie mit ihrem Smartphone mit Familie und Freund*innen in Kontakt bleiben, bei Sprachbarrieren übersetzen und einen Job oder Wohnungen suchen. Somit kann der digitale Zugang für Betroffene zu einer Stabilisierung beitragen, sogar inmitten von digitalen Gewalterfahrungen (Kröss 2020).
Wird der Zugang zu digitalen Räumen und Anwendungen eingeschränkt, können Betroffene noch mehr isoliert werden. Bei der Beratung zu möglichen Schutzmaßnahmen sollte also bedacht werden, dass für viele Betroffene digitale Teilhabe wesentlich für ihr gesellschaftliches Leben ist.
Auch um Täter-Opfer-Umkehr zu vermeiden, ist es wichtig zu betonen: Wenn der Täter entscheidet, Gewalt mit digitalen Mitteln auszuüben, dann liegt es in seiner Verantwortung.
Betroffene haben unterschiedliche Strategien im Umgang mit der (digitalen) Gewalt. Wollen Betroffene weiterhin online aktiv sein, sollten in ihrer digitalen Teilhabe gestärkt und Wege gesucht werden, wie sie weiterhin digital teilhaben können – mit möglichen Sicherheitsmaßnahmen, die im Beratungsprozess mit Betroffenen entwickelt werden können.
3. Mehrfachdiskriminierungen berücksichtigen
(Ex-)Partnerschaftsgewalt wird als geschlechtsspezifische Gewalt bezeichnet, weil Frauen überproportional stark betroffen sind. Dabei ist es wichtig, zu berücksichtigen, dass Frauen unterschiedliche Positionierungen in Bezug auf Klasse, Aufenthaltsstatus, Alter etc. haben.
Gesellschaftliche Machtverhältnisse prägen die Lebensrealitäten der Betroffenen und Beratenden. Die Machtverhältnisse beeinflussen auch digitale Gewalt (Cahill et al. 2024).
Täter können bestimmte Informationen oder Mittel nutzen, die mit Diskriminierungserfahrungen von Betroffenen zusammenhängen, um ihnen zu schaden, z. B.:
- bei der Veröffentlichung von privaten Daten im Internet (sog. Doxing). Es gibt LGBTQI-Personen, die in ihrem privaten Umfeld, bei der Arbeit oder in der Öffentlichkeit nicht geoutet sind. Dann kann die unerwünschte Enthüllung der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität einer Person, z. B. als Trans-Frau, für Betroffene gewaltvoll bis gefährlich sein. Doxing mit Zwangsouting betrifft spezifisch LGBTQI-Personen.
- durch die Beschädigung assistierender Technologien von Betroffenen mit Behinderung. Beispielsweise wenn Täter die Kommunikationsgeräte von Frauen mit Hörbehinderung, wie Hörgeräte, beschädigen, zerstören oder entwenden, um Betroffene weiter zu isolieren und zu kontrollieren.
Die Machtverhältnisse beeinflussen auch die Zugänge und Hürden von Betroffenen, um gegen Gewalt tätig zu werden (Pohlkamp et al. 2024).
Mehrfachdiskriminierungen zu berücksichtigen bedeutet, die Auswirkungen von Diskriminierungen nicht isoliert zu betrachten, z. B. bei einer geflüchteten von Gewalt betroffenen Frau mit Behinderung. Personen können von verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen sein und diese können sich gegenseitig beeinflussen.
Wenn die Lebensrealität der Betroffenen und ihre Diskriminierungserfahrungen anerkannt werden, wird eine betroffenenorientierte Beratung möglich. Zum Thema „Inklusiver Gewaltschutz“ bietet die Sondererhebung der Frauenhaus-Statistik von 2023 vertiefende Informationen.
4. Sicherheitsmaßnahmen gemeinsam mit Betroffenen entwickeln
Jede Betroffene verfügt über Expertise aufgrund ihrer eigenen Erfahrung. Dieses Wissen ist von großem Wert, damit Probleme auf eine Weise angegangen werden, die ihre Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung respektiert. Deshalb ist es hilfreich, sich in der Beratung an den Bedürfnissen der Betroffenen zu orientieren.
Die Aufgabe der Fachkräfte besteht darin, Betroffene zu beraten. Die Betroffene entscheidet dann, ob und welche Sicherheitsmaßnahmen sie umsetzen möchte. So werden Maßnahmen gemeinsam mit den Betroffenen entwickelt, anstatt stellvertretend für sie (Hussain, H. et al. 2022).
5. Ganzheitlich beraten
Für einen ganzheitliche Sicherheitsberatung zu digitaler Gewalt fließen diese vier Aspekte zusammen:
Quellen
- Cahill, R.; Wong, R. & Hoogendam, R. (2024): Insights Into Technology-Facilitated Gender-Based Violence: A Survey of Women’s Shelters and Transition House Workers Across Canada. Ottawa: Women’s Shelters Canada.
- Hussain, H./ Jethwa, N./ Meher, N./ Alexander Naidoo, N. (2002): Orbits – A global guide to advance intersectional, survivor-centered, and trauma-informed interventions to technology-facilitated gender-based violence. London: Chayn
- Kröss, A. (2020): Psychosoziale Berat des Vereins Wiener Frauenhäuser. In: Brem, A./ Fröschl, E. (2020): Cybergewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen. Eine empirische Untersuchung des Vereins Wiener Frauenhäuser. Wien: Verein Wiener Frauenhäuser, S. 39-42.
- NNDEV – National Network to End Domestic Violence (2025): Tech Talk 3 – Tech Misuse 101: Principles, Dynamics, and Safety Planning.
- Pohlkamp, I./ Wagner, J. / Kaschuba, G. (2024): Unterstützung von Frauenhäusern auf dem Weg zur Inklusion. Berlin: Frauenhauskoordinierung e.V.
Alle Links wurden am 05.11.2025 zuletzt abgerufen.
Verwandte Inhalte

Auswirkungen digitaler Gewalt

Studien & Statistiken

Was ist digitale Gewalt?
(auch Doxxing geschrieben), kommt vom englischen Wort „docs“, also „Dokumente“, und beschreibt eine Gewaltform, bei der Täter persönliche Informationen über eine Person suchen, zusammenstellen und online veröffentlichen. Dadurch sollen die Betroffenen geschädigt werden.