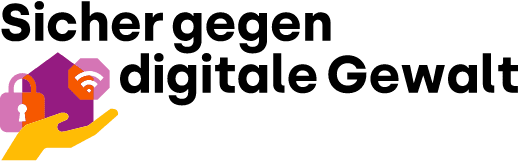Studien & Statistiken
Überblick
Wie häufig kommt digitale (Ex-)Partnerschaftsgewalt in Deutschland vor? Verlässliche Zahlen fehlen bisher, doch erste Studien und Statistiken zeigen: Digitale Gewalt ist ein ernstes und weitverbreitetes Problem, das Kontrolle, Überwachung und Einschüchterung ermöglicht. Dieser Beitrag gibt einen Überblick zu aktuellen Zahlen und dem Forschungsstand zu diesem Thema.
Wie verbreitet ist digitale (Ex-) Partnerschaftsgewalt in Deutschland?
Bislang existieren nur wenige Studien, die einen verlässlichen Rückschluss auf die Verbreitung von (Ex-)Partnerschaftsgewalt in Deutschland erlauben (z. B. Müller/Schröttle 2004, Jud et al. 2023). Erst recht gibt es keine allgemeingültigen Zahlen zur Verbreitung der digitalen Partnerschaftsgewalt in Deutschland. Deswegen muss auf die jährlichen Berichte des Bundeskriminalamts, d. h. auf die Angaben zu den polizeilich registrierten Fällen, zurückgegriffen werden. Dieses sogenannte Hellfeld umfasst nur einen Bruchteil der tatsächlichen Gewalt.

Das Hellfeld: Straftaten, die der Polizei bekannt sind
Das Bundeskriminalamt (BKA) erfasst in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) jährlich alle „der Polizei bekannt gewordenen strafrechtlichen Sachverhalte“ (BKA 2024: 1).
Die Ergebnisse zum Deliktbereich der (Ex-)Partnerschaftsgewalt werden im Lagebild Häusliche Gewalt zusammengefasst. Für 2023 berichtet das BKA in diesem Lagebild von 167.639 Fällen von (Ex-)Partnerschaftsgewalt. Das stellt einen Anstieg der Fälle um 6,4 % zum Vorjahr dar. Von den 167.865 Betroffenen sind 79,2 % weiblich und 20,8 % männlich. Da sich (Ex-)Partnerschaftsgewalt überwiegend gegen Frauen richtet, wird sie auch als geschlechtsspezifische Gewalt bezeichnet.
Im Lagebild wird neben Körperverletzung, sexuellen Übergriffen und Tötungsdelikten auch Bedrohung, Stalking und Nötigung erfasst. Nahezu ein Viertel (24,9 %) der Fälle von (Ex-)Partnerschaftsgewalt wird den Deliktkategorien Bedrohung, Stalking und Nötigung zugeordnet. Für diese Delikte wird zudem angegeben, ob zur „Tatbestandsverwirklichung das Medium Internet als Tatmittel verwendet“ wird (BKA 2024: 25). Somit sind auch Formen digitaler Gewalt erfasst. Zum Einsatz kam das „Tatmittel Internet“ bei 7,3 % der Nötigungsfälle, 8,7 % der Bedrohungsfälle und 16,4 % der Stalkingfälle (vgl. BKA: 5, 25).
Das Dunkelfeld: alle Straftaten, die polizeilich nicht erfasst sind
Das Dunkelfeld umfasst alle Fälle von (digitaler) (Ex-)Partnerschaftsgewalt in Deutschland, die der Polizei nicht angezeigt werden. Diese Fälle sind mutmaßlich um ein Vielfaches höher als das Hellfeld (vgl. z. B. Bosold et al. 2024). Das Dunkelfeld ist also entscheidend, um das tatsächliche Ausmaß von Straftaten zu verstehen.
Aktuell befragt eine Studie mit dem Titel „Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag“ (LeSuBiA) 15.000 Männer und Frauen aus ganz Deutschland zu ihren Gewalterfahrungen. Dabei wird explizit nach Erfahrungen mit digitaler Gewalt gefragt, auch im Kontext von (Ex-)Partnerschaftsgewalt, sexualisierter Gewalt und Stalking. Die Studie, die in Zusammenarbeit zweier Bundesministerien mit dem BKA entwickelt und durchgeführt wird, dürfte so endlich belastbares Datenmaterial zur Verbreitung von (Ex-)Partnerschaftsgewalt in Deutschland liefern.
Studien zu Dynamiken digitaler (Ex-)Partnerschaftsgewalt
Auch wenn belastbare Daten zum quantitativen, also dem zahlenmäßigen, Ausmaß noch fehlen, erlauben verschiedenen Studien einen Einblick in die qualitative Dimension des Problems: also darüber, wie digitale (Ex)Partnerschaftsgewalt abläuft, welche Zwecke Täter mit dem Einsatz digitaler Technologien verfolgen und welche Auswirkungen das auf die Betroffenen haben kann.
Wichtige Studien für den deutschsprachigen Raum sind z. B. bff/Prasad 2019, Fröschl/Brem 2020 und Habringer et al. 2023. Sie zeigen: Digitale Gewalt gegen (Ex)Partner*innen ist ein komplexes und vielfältiges Phänomen mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Betroffenen.
Im Folgenden möchten wir einen Überblick über die wichtigsten Forschungsergebnisse zu den Dynamiken digitaler (Ex-)Partnerschaftsgewalt geben.
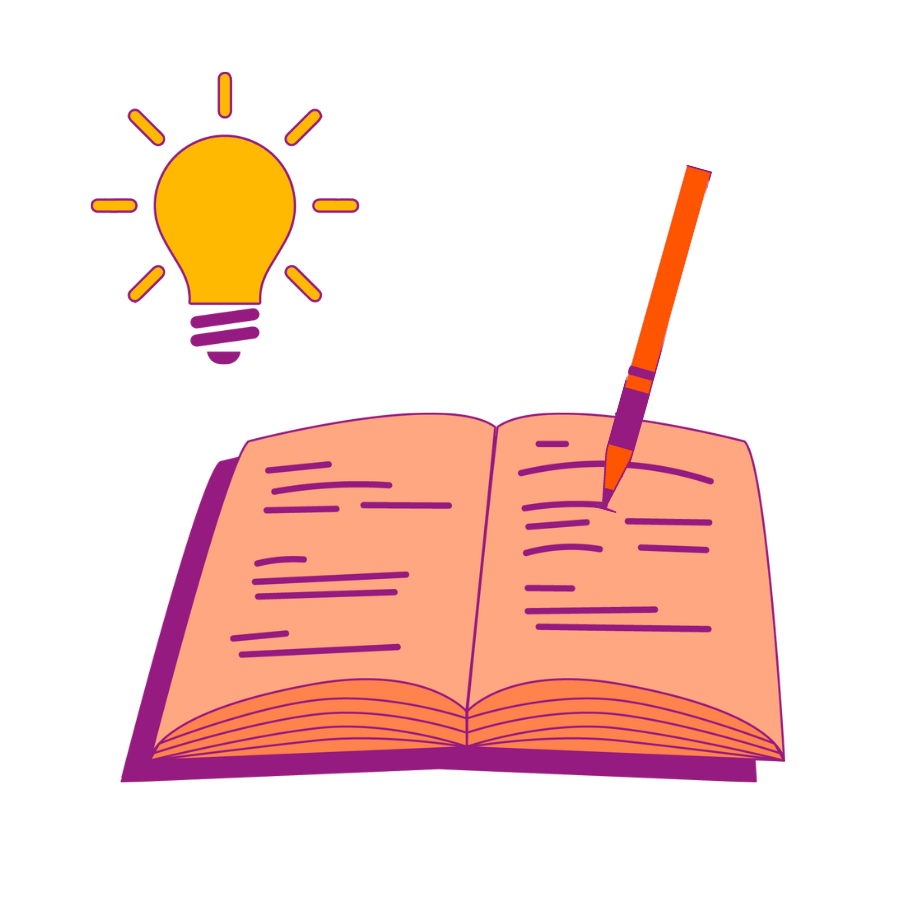
Kontrolle und Überwachung
Eine zentrale Form der digitalen (Ex-)Partnerschaftsgewalt ist die durch den Einsatz von Technologie ausgeübte Kontrolle von (ehemaligen) Lebenspartner*innen. Diese Kontrolle kann offen oder verdeckt ausgeübt werden und zu einer völligen Überwachung führen. Beispiele sind die Kontrolle des Smartphones durch Stalkerware oder die Ortung des Standortes durch GPS- oder Bluetooth-Tracking-Geräte.
Mithilfe von Smart-Home-Technologien können außerdem viele Aspekte des heimischen Alltags kontrolliert werden, z. B. im Wohnbereich durch smarte Kameras, Türschlösser, Thermostate, Jalousien oder Lautsprecher (vgl. Bauer/Hartmann 2019: 63-76, Fröschl/Brem 2020: 13f., Grave/Nagel 2022: 6, Habringer et al. 2023: 25-30, Köver 2019, Tanczer 2019).
Einschüchterung und Beschämung
Eine weitere Form digitaler (Ex-)Partnerschaftsgewalt ist die konstante, unerwünschte Kontaktaufnahme mit dem Ziel der Einschüchterung von Betroffenen. Dies wird durch digitale Kommunikationstechnologien wie WhatsApp, E-Mails oder Direktnachrichten auf Social-Media-Plattformen umgesetzt.
Oft kommt es auch zu Formen der öffentlichen Beschämung oder Bedrohung, z. B. indem Täter auf ihren Social-Media-Kanälen private Informationen (wie die private Adresse, sog. Doxing) oder auch Bilder/Videos veröffentlichen. Dieser bildbasierte Missbrauch kann (un-)freiwillig aufgenommenes Bildmaterial der Betroffenen umfassen, aber auch gefälschte Aufnahmen, wie die mit künstlicher Intelligenz generierten Deepfakes. Diese Formen von digitaler (Ex-)Partnerschaftsgewalt haben häufig eine sexuelle Komponente. Dann spricht man auch von „bildbasierter sexualisierter Gewalt“ (vgl. Bauer/Hartmann 2019: 76-89, Fröschl/Brem 2020: 14f., Grave/Nagel 2022: 7, Habringer et al. 2023: 20-24).
Isolation und Omnipräsenz
Digitale Gewaltpraktiken führen vielfach zu einer Isolation von Betroffenen, wenn z. B. die Nutzung spezifischer Geräte oder Accounts kontrolliert oder gar untersagt wird oder Betroffene sich aus Angst oder Scham immer weiter aus ihrem sozialen Umfeld zurückziehen. Das erschwert eine Trennung enorm (vgl. Bauer/Hartmann 2019: 85, Fröschl/Brem 2020: 14f.).
Aber auch wenn eine (räumliche) Trennung gelingt, vermitteln digitale Gewaltformen den Betroffenen weiterhin das Gefühl, der Täter sei allgegenwärtig. Auch nach einer Trennung besteht häufig noch die Angst, dass neue Geräte wieder gehackt und zum Ausspionieren oder Terrorisieren verwendet werden könnten (vgl. Fröschl/Brem 2020: 16ff.; Leitão 2019, Rogers et al. 2023).
Zusätzliche Gewaltdimensionen werden zur Herausforderung
Häufig ergänzt oder verstärkt digitale (Ex-)Partnerschaftsgewalt bestehende Gewaltformen. Das heißt, die digitalen Gewaltpraktiken treten oft in Kombination mit körperlichen, sexualisierten, psychischen oder finanziellen Formen der (Ex-)Partnerschaftsgewalt auf (Fröschl/Brem 2020: 13, Habringer et al.: 2023: 116f., Prasad 2019: 25ff.). Die örtliche und zeitliche Entgrenzung des Missbrauchs mit digitalen Mitteln erschwert Interventionen. Das erhöht auch das Risiko von Nachtrennungsgewalt (vgl. Habringer et al. 2023: 45). Daraus entstehen für die Betroffenen neue Belastungen und für Frauenhäuser, Beratungsstellen, Polizei und Justiz neue Herausforderungen in der Bekämpfung von (Ex-)Partnerschaftsgewalt.
Digitale Gewalt kann für Betroffene besonders einschneidend sein, wenn diese auf ihre digitalen Geräte angewiesen sind, z. B. bei bestehenden Behinderungen, Familienmitgliedern im Ausland oder ländlichem Wohnraum. Viele Betroffene haben außerdem nicht die finanziellen Mittel, technische Geräte einfach auszutauschen oder zu ersetzen, wenn diese von Tätern kontrolliert, weggenommen oder zerstört werden.
Sind Kinder Teil von Gewaltkonstellationen, können auch ihre Geräte oder das elterliche Kontaktrecht zu Kontroll- und Überwachungszwecken missbraucht werden (vgl. Brem/Fröschl 2020: 18f., Grave/Nagel 2022: 23f., Habringer et al. 2023: 82).
Professionelle (Beratungs-)Arbeit
Einen besonders ausführlichen Einblick in diese Herausforderungen und mögliche Konzepte zum professionellen Umgang mit digitaler (Ex-)Partnerschaftsgewalt geben z. B. die Studien der Fachhochschule Wien (Habringer et al. 2023) und des Vereins Wiener Frauenhäuser (Fröschl/Brem 2020).
Der interne Bereich dieses Fachkräfteportals bietet Fachkräften aus dem Frauengewaltschutz ebenfalls vertiefende Informationen.

Dieser Artikel wurde von Dr. Viola Dombrowski und Prof. Dr. Nicole Zillien verfasst.
Quellen
- Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff)/Prasad, N. (2021): Geschlechtsspezifische Gewalt in Zeiten der Digitalisierung. Formen und Interventionsstrategien. Bielefeld: transcript Verlag.
• Bauer, J.-K./Hartmann, A.: Formen digitaler geschlechtsspezifischer Gewalt, S. 63-99.
• Köver, C.: Der Feind in der eigenen Tasche. Stalkerware und digitale Überwachung im Kontext von Partnerschaftsgewalt, S. 227-238.
• Prasad, N.: Digitalisierung geschlechtsspezifischer Gewalt. Zum aktuellen Forschungsstand, S. 17-46.
• Tanczer, L.: Das Internet der Dinge. Die Auswirkungen „smarter“ Geräte auf häusliche Gewalt, S. 205-225.
- Müller, U./Schröttle, M. (2004): Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland.
Alle Links wurden am 05.11.2025 zuletzt abgerufen.
Verwandte Inhalte

Was ist digitale Gewalt?
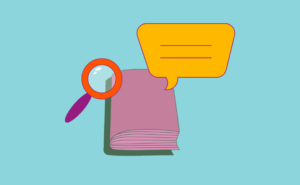
Weiterführende Materialien
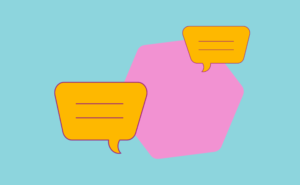
Grundsätze der Beratung
sind Programme, die die digitalen Aktivitäten einer Person ohne deren Wissen oder Zustimmung überwachen. Viele Aktivitäten und Informationen auf dem Smartphone der Betroffenen können vom Täter so ausspioniert werden: vom Aufenthaltsort mit Fotos und Videos über Chatverläufe bis hin zu Anrufprotokollen.
umfasst Haushaltsgeräte, die mit dem Internet verbunden sind und automatisiert gesteuert sowie ferngesteuert werden können. Es gibt z. B. smarte Türschlösser, Heizungen und Beleuchtung.
ist eine Technologie, mit der Daten zwischen Geräten über kurze Entfernungen übertragen werden können. Dafür wird Funktechnik genutzt. Zum Beispiel können kabellose Kopfhörer oder Tastaturen über Bluetooth mit einem anderen Gerät verbunden werden.
ist ein mithilfe von künstlicher Intelligenz gefälschter Medieninhalt, der täuschend echt wirkt. Meist handelt es sich um gefälschte Video- oder Fotoaufnahmen.
ist ein Benutzerkonto, das eine Person auf einer Webseite oder in einer App anlegt, um sich zu anzumelden.
(auch Doxxing geschrieben), kommt vom englischen Wort „docs“, also „Dokumente“, und beschreibt eine Gewaltform, bei der Täter persönliche Informationen über eine Person suchen, zusammenstellen und online veröffentlichen. Dadurch sollen die Betroffenen geschädigt werden.
ist eine Technologie, die mithilfe von Satelliten Geräte mit GPS-Empfang – wie zum Beispiel Smartphones oder Tablets – orten kann.
ist ein Programm, das auf mobilen Geräten, wie Smartphones und Tablets, verwendet werden kann. Es gibt Apps für alle möglichen Zwecke: vom Versenden von Nachrichten über soziale Medien bis zum Onlinebanking. App ist die Kurzform des englischen Wortes „application“ (Anwendung).