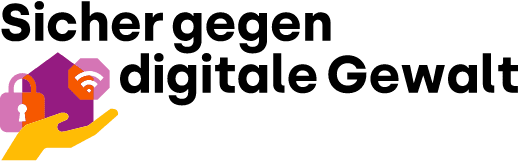Was ist digitale Gewalt?
Überblick
Digitale Gewalt endet nicht an der Tür des Frauenhauses. Täter nutzen Smartphones, soziale Medien oder Ortungsgeräte, um Kontrolle und Überwachung fortzusetzen – oft auch, wenn Betroffene bereits im Frauenhaus sind. Der Beitrag gibt eine Einführung in das Thema digitale Gewalt in Frauenhäusern.
Fokus auf (Ex-)Partnerschaftsgewalt
Der Begriff „digitale Gewalt“ umfasst sehr unterschiedliche Gewaltformen: von Cybermobbing im Schulkontext über Hatespeech gegenüber Politiker*innen bis hin zu Cyberstalking durch Ex-Partner. Dieses Fachkräfteportal richtet den Fokus auf digitale (Ex-)Partnerschaftsgewalt. Wir verwenden den Begriff „digitale Gewalt“ als Abkürzung für „digitale (Ex-)Partnerschaftsgewalt“.
Täter nutzen in gewaltvollen (Ex-)Partnerschaften digitale Wege, um Betroffene zusätzlich zu kontrollieren und zu überwachen. Betroffene von (Ex-)Partnerschaftsgewalt erleben digitale Gewalt meist gemeinsam mit körperlicher und psychischer Gewalt. So verstärken Täter die Machtverhältnisse und Gewaltdynamiken. Täter verwenden zum Beispiel technische Geräte wie Smartphones, Laptops oder Ortungsgeräte, um Betroffene zu überwachen, sie von ihrem sozialen Umfeld zu isolieren, zu erpressen oder ihren Ruf zu schädigen (Grave/Nagel 2022).
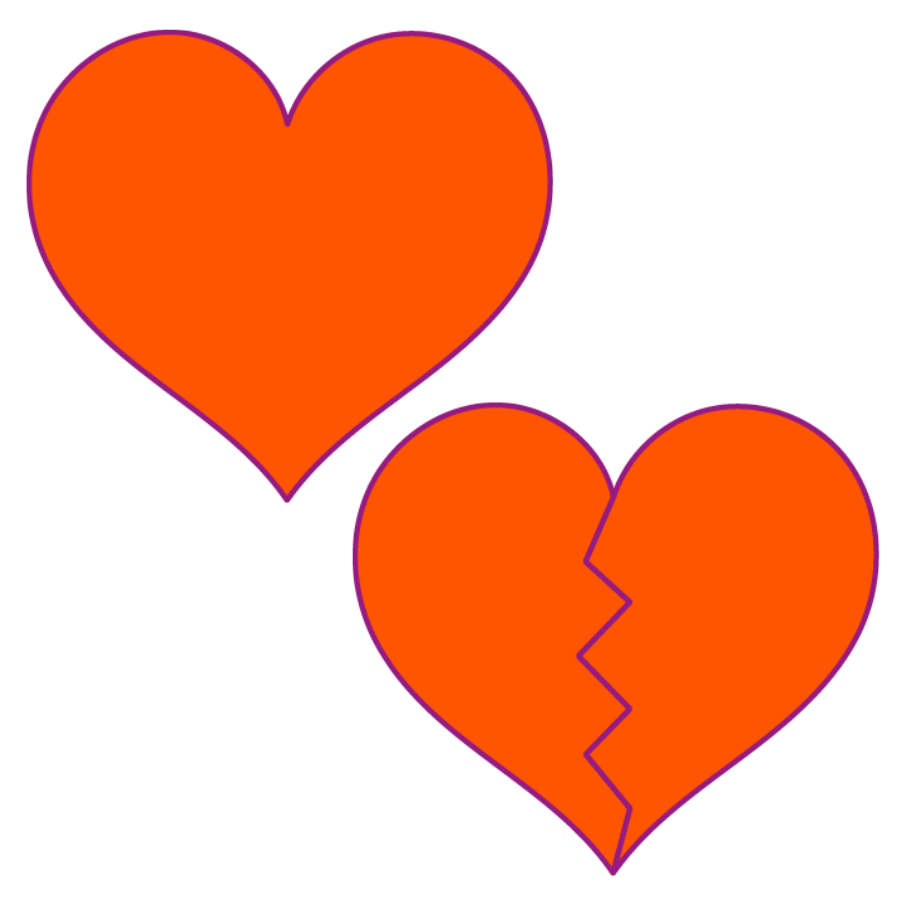
Digitale Gewalt gefährdet Frauenhäuser als Schutzorte
Digitale Gewalt stellt eine zunehmende Bedrohung für Betroffene und für Frauenhäuser als Schutzort dar. Selbst wenn Betroffene in ein Frauenhaus flüchten, hört die Gewalt nicht automatisch auf: Gefährder können Betroffene weiterhin digital erreichen oder überwachen.
Häufig sind nicht nur die Frauen selbst, sondern auch ihre Kinder von der digitalen Gewalt betroffen. Über die Kinder können Gefährder Kontakt zur Betroffenen aufnehmen und den Druck auf diese erhöhen (Dragiewicz et al. 2020).
Häufige digitale Gewaltformen im Frauenhaus
In Frauenhäusern treten diese fünf digitalen Gewaltformen besonders häufig auf:
Unerwünschte Kontaktaufnahme:
wenn der Gefährder die Betroffene durch Anrufe, Nachrichten über Messenger, Social Media, E-Mails etc. belästigt, bedroht oder terrorisiert. Gemeinsame Kinder sind oft ebenfalls betroffen.
Ortung und Überwachung:
wenn der Gefährder mithilfe technischer Geräte die Betroffene ortet und überwacht. In Hochrisikofällen kann es für die Sicherheit der Betroffenen besonders wichtig sein, dass ihr Aufenthaltsort geheim bleibt. Zunehmend gibt es Fälle, in denen Täter den gemeinsamen Kindern digitale Geräte schenken, um darüber den Standort des Frauenhauses herauszufinden.
Identitätsmissbrauch und -diebstahl:
wenn der Gefährder personenbezogene Daten der Betroffenen missbräuchlich verwendet und z. B. mit ihren Kontodaten Waren bestellt. Auch Fake-Profile in den sozialen Medien gehören dazu. So können Täter andere manipulieren und Falschaussagen oder Gerüchte streuen.
Verbreitung intimer Fotos oder Videos (sogenannte bildbasierte Gewalt):
wenn intime Fotos oder Videos ohne Zustimmung der Betroffenen vom Täter erstellt, online veröffentlicht oder an Freund*innen, Kolleg*innen und Familienmitglieder der Betroffenen weitergeleitet werden. Auch die Androhung der Veröffentlichung solcher Fotos oder Videos und die Erpressung damit ist digitale Gewalt.
Unerwünschte Posts in den sozialen Medien (sogenannte digitale Diffamierung):
wenn der Gefährder Gerüchte, Beschimpfungen, Rufschädigungen, Bloßstellungen oder Beleidigungen über soziale Medien verbreitet. Dazu gehört auch, dass der Gefährder online eine Vermissten-Anzeige veröffentlicht, um herauszufinden, wo sich die Betroffene aufhält.
Die oben genannten Formen digitaler Gewalt werden häufig unter dem Begriff Cyberstalking zusammengefasst. Beim Cyberstalking stellt ein Täter der Betroffenen wiederholt über einen längeren Zeitraum gegen ihren Willen im digitalen Raum nach. Diese Nachstellungen können unterschiedliche Lebensbereiche umfassen.
Wege aus der Gewalt
Betroffene digitaler Gewalt fühlen sich oft gefangen, isoliert und ständig beobachtet (Habringer et al. 2023). Dadurch fällt es ihnen schwer, Hilfe zu suchen oder aus der missbräuchlichen Beziehung zu fliehen. Besonders Betroffene, die Mehrfachdiskriminierungen erleben, sind mit zusätzlichen Hürden und Barrieren auf dem Weg aus der Gewalt konfrontiert.
Das Erkennen von Hinweisen auf digitale Gewalt ist ein entscheidender erster Schritt, um den Betroffenen zu helfen. Viele Menschen, die digitale Gewalt erleben, sind sich nicht bewusst darüber, dass es sich dabei um eine Form von Gewalt handelt (Habringer et al. 2023). Deswegen ist es wichtig, die dabei angewandten Methoden und ihre verheerenden Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Betroffenen zu verstehen.

Quellen
- Grave, B./Nagel, B. (2022): Bewohner*innenperspektiven auf den Schutz vor digitaler Gewalt im Frauenhaus. Berlin: Frauenhauskoordinierung e. V.
- Dragiewicz M, O’Leary P, Ackerman J, et al. (2020) Children and technology-facilitated abuse in domestic and family violence situations: Full report.
- Habringer, M./Hoyer-Neuhold, A./ Messner, S. (2023): (K)ein Raum. Cyber-Gewalt gegen Frauen in (Ex-)Beziehungen. Wien.
Alle Links wurden am 05.11.2025 zuletzt abgerufen.
Verwandte Inhalte

Studien & Statistiken

Auswirkungen digitaler Gewalt
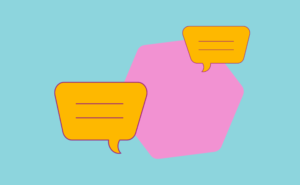
Grundsätze der Beratung
bedeutet eine Schädigung des Rufs einer Person durch öffentlich gemachte falsche Behauptungen oder Beleidigungen. Die betroffene Person wird dabei herabgesetzt und beschämt.